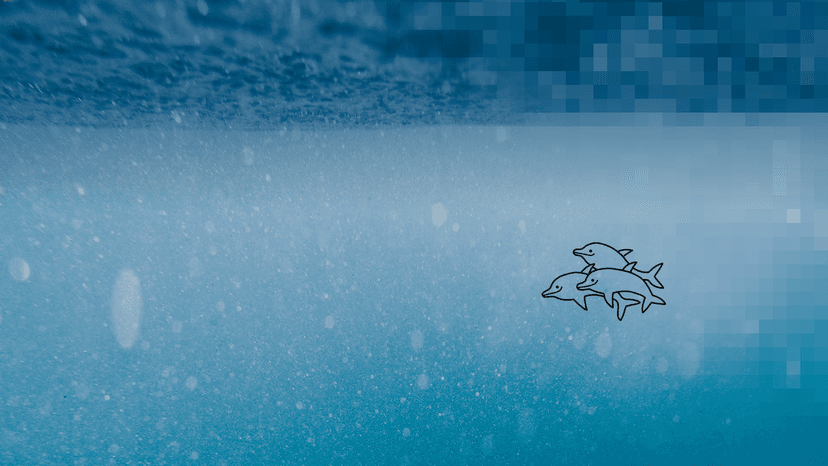Digitale Zukunft braucht Haltung – Eindrücke von der re:publica 2025
Vom 26. bis 28. Mai 2025 fand die re:publica in der Station Berlin statt, ein wichtiger Treffpunkt für digitale Denker:innen, Innovator:innen und Gesellschaftskritiker:innen.
In diesem Artikel liest du:
- Digitale Transformation mit Verantwortung denken
- Generation XYZ – Willkommen in der digitalen Zukunft
- Markus Beckedahl: Eine bessere digitale Welt ist trotz alledem möglich
- André Frank Zimpel: Wie eine Symbiose aus Neurodiversität & KI die Demokratie retten könnte
- Sarah Bosetti: Poesie gegen Populismus: Nebenschauplätze unserer Diskussionskultur
- Maja Göpel: Reaktionär. Generationen, Zeitgeister und Zukunft
- Panel: Macht, Platz! Generation Diversity im Journalismus
- Natascha Strobl: Vom Schwarzhemd zu TikTok. Postmoderner Faschismus
- Katharina Nocun: Unterschätze niemals die Macht der Verdrängung!
- Bob Blume: 404: Bildung not found - Wie Lernen wieder berühren kann
- Fazit
Digitale Transformation mit Verantwortung denken
Unter dem diesjährigen Motto „Generation XYZ“ setzten sich die Teilnehmenden mit den Herausforderungen und Chancen auseinander, die die digitale Zukunft mit sich bringt. Auch wir von Rheindigital waren vor Ort und haben uns nicht nur mit den neuesten Entwicklungen aus der Netz-Welt beschäftigt, sondern vor allem darüber nachgedacht, wie wir als Agentur dazu beitragen können, eine digitale Zukunft zu gestalten, die allen zugutekommt.
Die re:publica ist für uns kein klassisches Event, bei dem es nur um technische Trends geht. Vielmehr geht es darum, die digitale Transformation mit Verantwortung zu denken – und das ist ein Thema, das uns als Agentur besonders am Herzen liegt. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige der spannendsten Vorträge und Diskussionen, die uns neue Perspektiven für die Beratung unserer Kunden eröffnet haben.
Generation XYZ – Willkommen in der digitalen Zukunft
Das Opening der re:publica 2025 war ein kraftvolles Statement zur Bedeutung von Digitalisierung, Verantwortung und Demokratie. Die Gründer Tanja Haeusler, Johnny Haeusler, Markus Beckedahl und Andreas Gebhard begrüßten die Teilnehmenden und machten deutlich, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr eine Plattform für die Gestaltung einer besseren digitalen Zukunft ist.
Mit dem Motto "Generation XYZ" wiesen sie darauf hin, dass jede Generation ihre eigene Superkraft hat. Während Gen X Systeme hackt, baut Gen Y Communities und Gen Z lässt Bewegungen viral gehen. Doch trotz aller digitalen Innovationen bleibt das zentrale Anliegen der re:publica, dass Technologie nicht als Selbstzweck verstanden wird, sondern als Werkzeug zur Förderung von Demokratie und gemeinschaftlicher Verantwortung.
Besonders betonten sie, dass wir die digitale Zukunft aktiv gestalten müssen und dass diese Zukunft in unseren Händen liegen muss, nicht in denen von Technokraten oder Milliardären. Dabei wird die Notwendigkeit einer starken digitalen Souveränität und der Kampf gegen digitale Desinformation immer drängender.
Mit dieser Eröffnungsrede setzten die Gründer einen klaren Fokus auf die Verantwortung, die jede und jeder Einzelne von uns in der digitalen Welt trägt.

Unsere Top 8 Impulse der re:publica 2025
1. Markus Beckedahl: Eine bessere digitale Welt ist trotz alledem möglich
Markus Beckedahl, Netzaktivist und Mitgründer der re:publica, begeisterte in seiner Keynote mit einer beeindruckenden Reflexion über die digitale Geschichte Deutschlands. Er beleuchtete den Weg von den ersten Digitalministerien bis zu den aktuellen Herausforderungen der digitalen Souveränität.
Beckedahl erinnerte uns daran, dass die digitale Gesellschaft mehr ist als nur Technologie, sie muss auch Werte wie Offenheit und Demokratie verkörpern. Dabei stellte er klar, dass wir an einem „Wegweiser“ stehen, an dem es entscheidend ist, die richtige Richtung einzuschlagen.

Für uns als Agentur bedeutet das, dass wir nicht nur auf technologische Trends achten, sondern auch die gesellschaftliche Verantwortung, die digitale Lösungen mit sich bringen, im Blick haben. Wie können wir dazu beitragen, dass digitale Produkte und Dienstleistungen nicht nur wirtschaftlichen Erfolg bringen, sondern auch den sozialen Zusammenhalt fördern und Werte wie Demokratie und Inklusion wahren?
Beckedahl forderte uns dazu auf, die Kontrolle über unsere digitalen Infrastrukturen zurückzuerlangen. Dies erfordere einen stärkeren Fokus auf Open Source, unabhängige Medien und zivilgesellschaftliche Beteiligung.
2. André Frank Zimpel: Wie eine Symbiose aus Neurodiversität & KI die Demokratie retten könnte
André Frank Zimpel, Fachbuchautor und Professor, sprach auf der re:publica 2025 darüber, wie Neurodiversität und Künstliche Intelligenz (KI) die Demokratie stärken könnten. Er stellte die Frage, ob Neurodivergenz – die Vielfalt menschlicher Denkweisen – die bislang größte, aber wenig genutzte Ressource darstellt.
Zimpel betonte, dass die Gesellschaft nicht nur auf rationales Denken setzen sollte, sondern auch alternative Denkweisen fördern muss. Insbesondere neurodivergente Menschen, wie jene im Autismus- oder ADHS-Spektrum, haben eine besondere Fähigkeit, Probleme aus ungewöhnlichen Perspektiven zu betrachten, was vor allem in der Cybersicherheit von Bedeutung ist. Zimpel argumentierte, dass diese Perspektiven durch KI besser genutzt werden könnten, um eine inklusivere Gesellschaft zu schaffen.
Für uns als Agentur sind Zimpels Ideen besonders wertvoll, um zu verstehen, wie wir KI und Diversität verantwortungsbewusst einsetzen können. Sie ermutigen uns, Lösungen zu entwickeln, die sowohl technisch effizient als auch gesellschaftlich gerecht sind.

3. Sarah Bosetti: Poesie gegen Populismus: Nebenschauplätze unserer Diskussionskultur
Sarah Bosetti, Kabarettistin, Autorin und Moderatorin, zeigte auf der re:publica 2025 eindrucksvoll, wie Humor zur Waffe gegen Hass, Hetze und digitale Desinformation werden kann.

Mit kluger Ironie und sprachlicher Präzision sezierte Bosetti, wie sich rechte Narrative, Fake News und Empörungsmechanismen in der digitalen Öffentlichkeit ausbreiten und wie wir ihnen begegnen können, ohne zynisch oder sprachlos zu werden. Ihr Ansatz: Die Dinge beim Namen nennen, aber sie so formulieren, dass man sie nicht nur versteht, sondern auch fühlt. Und dabei lachen kann, nicht über andere, sondern über die Absurdität der Mechanismen, die uns spalten sollen.
Sie machte deutlich: Humor bedeutet nicht, sich zurückzulehnen. Er kann ein Werkzeug sein, um Dinge sichtbar zu machen, die sonst untergehen und um Gesprächsräume zu öffnen, wo der Diskurs längst vergiftet scheint. Gerade in einer digitalen Welt, in der Empörung oft schneller ist als Nachdenken, braucht es mehr Stimmen wie ihre: laut, klug, unbequem, menschlich.
Für unsere eigene Arbeit war das ein Impuls, Humor nicht nur als Stilmittel zu begreifen, sondern als Haltung. Als Möglichkeit, komplexe Themen zugänglich zu machen, ohne sie zu banalisieren. Und als Mittel, um in digitalen Kommunikationsstrategien nicht nur Sichtbarkeit zu erzeugen, sondern auch Bewusstsein.
4. Maja Göpel: Reaktionär. Generationen, Zeitgeister und Zukunft
Maja Göpel, Transformationsforscherin, Autorin und eine der wichtigsten Stimmen für Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit im deutschsprachigen Raum, brachte auf der re:publica 2025 das große Bild mit: Wie kann Digitalisierung zu einem Werkzeug werden, nicht für noch mehr Wachstum um jeden Preis, sondern für eine lebenswertere Zukunft?
Ihr Vortrag war kein Appell gegen Technologie. Sondern ein Weckruf dafür, wie wir Technologie anders denken müssen. Göpel machte deutlich: Die Frage ist nicht, ob wir digitalisieren, sondern wie, mit welchen Zielen und für wessen Nutzen. Denn aktuell folgen digitale Entwicklungen oft einer Logik der Effizienz und des Profits. Was dabei auf der Strecke bleibt: ökologische Grenzen, soziale Gerechtigkeit, der Blick aufs große Ganze.
Stattdessen plädiert Göpel für eine „planetare Perspektive“. Digitalisierung müsse so gestaltet werden, dass sie den sozial-ökologischen Umbau unterstützt, etwa durch smarte Ressourcensteuerung, transparente Lieferketten oder neue Formen des Teilens und Zusammenlebens. Dafür brauche es aber neue Narrative: weg von der vermeintlich „alternativlosen“ Technologiegläubigkeit, hin zu echten Entscheidungen, echten Gestaltungsräumen.

Was uns besonders hängen blieb: Ihr Appell, sich nicht von vermeintlicher Alternativlosigkeit einschüchtern zu lassen. Transformation bedeutet nicht, dass alles digital wird, sondern dass wir als Gesellschaft entscheiden, was sinnvoll, gerecht und nachhaltig ist. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie ist ein Werkzeug. Und wir müssen lernen, es richtig zu nutzen.
Für unsere Arbeit heißt das: Nicht nur Tools und Trends zu beobachten, sondern aktiv mitzugestalten, wie und wofür sie eingesetzt werden. Denn auch Kommunikation ist Teil dieser Transformation und kann dazu beitragen, dass aus klugen Ideen konkrete Veränderungen werden.
5. Panel: Macht, Platz! Generation Diversity im Journalismus
Dieses Panel beleuchtete die strukturellen Barrieren im Journalismus und diskutierte, wie Diversität und Inklusion als treibende Kräfte für echten Wandel im Mediensektor verstanden werden sollten. Ein wichtiger Punkt der Diskussion war die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung in den Medien. Ihre Perspektiven sind in vielen Bereichen der Medienlandschaft immer noch unterrepräsentiert, was zu einer unvollständigen Repräsentation von Gesellschaft und ihren unterschiedlichen Erfahrungen führt. Es wird deutlich, dass es nicht nur um die Inklusion von Menschen mit Behinderung geht, sondern um die Schaffung von Möglichkeiten zur Identifikation für alle Zuschauer:innen und Leser:innen. Medien, die diese Perspektiven nicht abbilden, verpassen die Chance, eine breitere und vielfältigere Zielgruppe anzusprechen.
An der Diskussion nahmen Raul Krauthausen, Janboris Ann-Kathrin Rätz und Selin Amil teil. Sie beleuchteten aus unterschiedlichen Perspektiven, wie der Mediensektor nach wie vor strukturelle Hürden für marginalisierte Gruppen aufbaut und was sich ändern muss, um diese Gruppen besser zu repräsentieren.
In der Beratung unserer Kunden nehmen wir diese Diskussionen als Impuls, Vielfalt und Repräsentation noch gezielter in die kreative Arbeit einzubringen. Es geht nicht nur darum, aktuelle Diversitätstrends zu berücksichtigen, sondern vor allem darum, die Repräsentation und Identifikation aller Gruppen zu fördern.

6. Natascha Strobl: Vom Schwarzhemd zu TikTok. Postmoderner Faschismus
Natascha Strobl, österreichische Politikwissenschaftlerin, Autorin und eine führende Expertin im Bereich Rechtsextremismus und Faschismus, beleuchtete in ihrem Vortrag den „postmodernen Faschismus“ und zeigte, wie Faschismus und Rechtsextremismus zunehmend die digitale Welt für sich nutzen.
Besonders hob sie dabei hervor, wie Plattformen wie TikTok von rechten Bewegungen verwendet werden, um eine junge Zielgruppe zu erreichen. Sie erklärte, dass TikTok mit seiner algorithmischen Struktur und der schnellen Verbreitung von Inhalten perfekt für die Verbreitung extrem rechter Ideologien geeignet sei, da es nicht nur eine breite Reichweite hat, sondern auch eine Form von Narrativen ermöglicht, die sich schnell verbreiten, ohne dass die Inhalte tief hinterfragt werden müssen.

Strobl betonte, dass diese Plattformen es Rechtsextremen ermöglichen, durch „Lifestyle“-Content und vermeintlich unpolitische Videos ihre Ideologien in einer Weise zu verbreiten, die weniger abschreckend wirkt als traditionelle, explizit politische Inhalte. Sie zeigte, wie die extreme Rechte TikTok nutzt, um junge Menschen durch eine Mischung aus Unterhaltung und Politik zu erreichen, was für viele dieser Plattformen-Nutzer:innen kaum als politisch wahrgenommen wird. Diese Art der „verdeckten“ Propaganda sei besonders gefährlich, da sie subtil und unauffällig in den Alltag der Nutzer eindringt.
7. Katharina Nocun: Unterschätze niemals die Macht der Verdrängung!
Katharina Nocun, Publizistin und Expertin im Bereich Digitalisierung und Demokratie, liefert in ihrem Vortrag eine erschreckend klare Analyse der aktuellen politischen Lage, die einen tief erschüttert und genau deshalb so wichtig ist. Ihre Botschaft ist kein neuer Horror, sondern eine Eskalation der bereits bestehenden Probleme: Drohungen gegen Richter:innen, Einschüchterung von Wissenschaftler:innen, die schleichende Normalisierung rechter Narrative in Talkshows, Wahlprogrammen und Institutionen.
Ein weiterer wichtiger Punkt in Nocuns Vortrag war die Rolle der Normalisierung extrem rechter und autoritärer Ideen. Sie machte deutlich, wie gefährlich es ist, wenn radikale Ideen im politischen Diskurs immer mehr akzeptiert werden. Besonders bemerkenswert ist, wie Krisen oder selbst inszenierte Krisenszenarien als Vorwand dienen, um drastische, autoritäre Maßnahmen durchzusetzen.

Ihr zentrales Argument: Wir verdrängen, als Gesellschaft und als Einzelne. Das mag verständlich sein, aber es ist gefährlich. Besonders kraftvoll ist Nocuns Blick auf die vermeintlich „harmlose Zeit davor“, die vielen kleinen Verschiebungen, die man nicht als Brüche erkennt. Erst im Rückblick erkennt man, wann der Punkt erreicht wurde, an dem sich die Dinge kippten. Sie ruft zu einem klaren Handeln auf: Reden, Erinnern, Handeln. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Mit Solidarität, mit Struktur und ja, auch mit Gummistiefeln im Schlamm. Ein Vortrag, der einem den Spiegel vorhält und ganz deutlich macht: Demokratie verteidigt sich nicht von selbst.
8. Bob Blume: 404: Bildung not found - Wie Lernen wieder berühren kann
Bob Blume, bekannt als „Netzlehrer“, forderte in seinem Vortrag eine grundlegende Neuausrichtung des Bildungssystems, weg von reinem Wissensabruf hin zu echter Berührung durch Bildung. Mit persönlichen Anekdoten und messerscharfer Analyse prangerte er Missstände wie den dramatischen PISA-Absturz, die wachsende Zahl an Schulabgänger:innen ohne Abschluss und fehlende psychologische Betreuung an.
Zentral war sein Appell, Bildung neu zu denken: als Erfahrungsraum, der Resonanz erzeugt, in der Schüler:innen nicht nur konsumieren, sondern gestalten, sich selbst entdecken und mit Welt in Beziehung treten. Blume plädierte für ein Bildungsverständnis, das Kreativität, Partizipation und Digitalkompetenz integriert, statt diese als „Zusatz“ zu behandeln.
Er forderte unter anderem:
- verbindliche und fächerübergreifende Medienbildung,
- De-Implementierung ineffektiver Routinen (z. B. klassische Klassenarbeitskorrekturen),
- personelle Ausstattung mit Sozialarbeiter:innen, Admins & psychologischer Betreuung,
- und den Mut zum produktiven Scheitern – bei Lehrkräften wie im System.
Seine Botschaft: Bildung ist kein lineares Vermitteln von Stoff, sie ist ein Raum für Beziehung, Gestaltung, Berührung. Und genau hier liegt die Kraft, Veränderung zu ermöglichen.

Fazit: Was wir mitnehmen
Die re:publica 2025 hat uns einmal mehr gezeigt: Wer heute in Kommunikation, Marketing und Beratung arbeitet, muss mehr als nur digitale Tools beherrschen, er oder sie muss Haltung zeigen, gesellschaftliche Entwicklungen verstehen und Verantwortung übernehmen. Für uns als Agentur war die Veranstaltung deshalb kein Blick in die ferne Zukunft, sondern ein Spiegel für unsere tägliche Arbeit.
Ob es um die Frage geht, wie wir Technologien sinnvoll und inklusiv einsetzen, wie wir mit Humor Diskurse öffnen oder wie wir in Zeiten der Desinformation glaubwürdig bleiben. Die Impulse der Speaker:innen haben uns inspiriert, unsere eigenen Rollen noch bewusster zu reflektieren: als Gestalter:innen einer digitalen Welt, die nicht nur effizient, sondern auch gerecht, zugänglich und menschlich ist.
Denn Kommunikation ist nie neutral, sie gestaltet Realitäten. Und wer diese gestalten will, muss wissen, wofür er oder sie steht.
Unsere Autorin Yvonne Cramer ist Creative Planner & Copywriter bei Rheindigital und setzt sich für Vielfalt und Demokratie ein.
Headerbild: re:publica/Jan Zappner
Links zu den erwähnten Beiträgen:
Opening
Markus Beckedahl: Eine bessere digitale Welt ist trotz alledem möglich
André Frank Zimpel: Wie eine Symbiose aus Neurodiversität & KI die Demokratie retten könnte
Sarah Bosetti: Poesie gegen Populismus: Nebenschauplätze unserer Diskussionskultur
Maja Göpel: Reaktionär. Generationen, Zeitgeister und Zukunft
Macht, Platz! Generation Diversity im Journalismus
Natascha Strobl: Vom Schwarzhemd zu TikTok. Postmoderner Faschismus
Katharina Nocun: Unterschätze niemals die Macht der Verdrängung!
Bob Blume: 404: Bildung not found - Wie Lernen wieder berühren kann
Du möchtest dein Unternehmen sichtbarer machen?
Und das mit Haltung?
Dann bist du hier genau richtig. Ruf uns an!